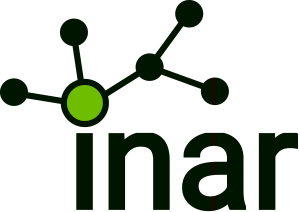Adipositas ist ein Zustand, der durch eine übermäßige Ansammlung von Fettgewebe im Körper gekennzeichnet ist. Die Adipositas wird heute als eine chronische Gesundheitsstörung verstanden. Sie beruht auf einer polygenetischen Veranlagung, geht mit einer hohen Begleit- und Folgemorbidität einher und erfordert ein langfristiges Behandlungs- und Betreuungskonzept. Übergewicht und Adipositas sind in der Bevölkerung epidemisch verbreitet. Etwa jeder dritte erwachsene Bundesbürger ist deutlich übergewichtig und sollte aus medizinischen Gründen Gewicht abnehmen. Längst ist unbestritten, dass Übergewicht und Adipositas hohe Kosten für das Gesundheitssystem verursachen. Knapp 5 % aller Gesundheitsausgaben in den Industrieländern werden für die Behandlung der Adipositas und ihrer Folgen aufgewendet.
1. Definition und Klassifikation
Übergewicht und Adipositas sind definiert als eine Vermehrung des Körpergewichtes durch eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfettanteiles. Eine graduierte Klassifizierung der Adipositas ist sinnvoll, um diejenigen Personen zu identifizieren, die ein erhöhtes Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko haben, und um adäquate Therapiestrategien entwickeln zu können. Die Klassifizierung der Adipositas erfolgt mit Hilfe des Körpermasseindex (Bodymass-Index = BMI). Der BMI ist der Quotient aus Gewicht und dem Quadrat der Körpergröße.
BMI
=
Gewicht (kg)
Größe (m)2;
Beispiel: Größe 1,78 m / Gewicht 96 kg
BMI
=
96 kg
(1,78m)2
=
96kg
3,17m2
=
30,3 kg/m2
Übergewicht und Adipositas werden anhand des BMI wie folgt klassifiziert (WHO Report 1995 und 1998):
BMI kg/(m)2;
Normalgewicht
18,5 – 24,9
Übergewicht
25,0 – 29,9
Adipositas Grad I
30,0 – 34,9
Adipositas Grad II
35,0 – 39,9
Extreme Adipositas Grad III
> 40
Der Quotient aus Taillen- und Hüftumfang (waist-hip-ratio, WHR) ist ursprünglich als ein Parameter für die Charakterisierung der abdominalen Adipositas identifiziert worden. Er sollte bei Männern unter 1,0 und bei Frauen unter 0,85 liegen. Ein weiterer Parameter für die Klassifizierung der Adipositas ist der Taillenumfang. Ein leicht bzw. stark erhöhtes Risiko liegt gemäß WHO vor, wenn der Taillenumfang bei Männern über 94 bzw. 102 cm und bei Frauen über 80 bzw. 88 cm liegt (Pouliot et al., 1994).
2. Epidemiologie
Verlässliche Daten zur Häufigkeit der Adipositas in der Bundesrepublik Deutschland gibt es erst seit wenigen Jahren von der DHP (Deutsche Herz-Kreislauf-Präventionsstudie) und dem MONICA-Projekt (Monitoring of International Trends and Determinants in Cardiovascular Disease) sowie den Erhebungen des Bundesgesundheitsamtes. Querschnittsuntersuchungen aus anderen Ländern sind nur beschränkt übertragbar, da die Häufigkeit der Adipositas wesentlich von ökonomischen, kulturellen, soziologischen und genetischen Faktoren geprägt wird. Nach der DHP-Studie, die 1990 an 4.700 repräsentativ ausgewählten Männern und Frauen im Alter zwischen 25 und 69 Jahren durchgeführt worden war, betrug der mittlere BMI für Männer 26,8. 51% der Bevölkerung waren übergewichtig (BMI = 25) und 19,3% der Frauen bzw. 17.2% der Männer adipös (BMI > 30). Von 1985 bis 1990 hat die Häufigkeit der Adipositas (BMI > 30) bei Männern und Frauen erheblich zugenommen: 1985: 15,1% der Männer bzw. 16,5% der Frauen, 1990: 17,2% der Männer bzw. 19,3% der Frauen) (Bergmann et al., 1989, Hofmeister et al., 1994). Im Rahmen des MONICA- Projektes wurden 1989/1990 in Augsburg und zwei benachbarten Landkreisen über 500.000 Personen (25- bis 75-jährig) erfasst. Der durchschnittliche BMI betrug bei Männern 26,9 und bei Frauen 26,0 (Filipiak et al., 1993). Die aktuellsten Daten liegen vom Bundesgesundheitsamt vor (BGA 1994) und sind 1994 veröffentlicht worden. Dabei wird für die Adipositas eine Prävalenz von 20% bestätigt. Aufgrund der vorliegenden Daten muss davon ausgegangen werden, dass jeder zweite erwachsene Bundesbürger übergewichtig (BMI = 25) und jeder fünfte bis sechste adipös (BMI = 30) ist. Im internationalen Vergleich gehört die Bundesrepublik Deutschland zu den Ländern mit sehr hoher Prävalenz der Adipositas, mit allgemein steigender Tendenz. Die Prävalenz der Adipositas im Kindesalter wird aufgrund ihres besonderen Stellenwertes gesondert betrachtet
3. Pathophysiologie
3.1 Genetik
Genetische Faktoren spielen für die Entstehung von Adipositas eine bedeutende Rolle. Mit Hilfe von Zwillings-, Adoptions- und Familienstudien konnte nachgewiesen werden, dass ein Großteil der interindividuellen Unterschiede des BMI erblich bedingt ist. (Bouchard et al., 1988; Stunkard et al., 1986) Studien an gemeinsam oder getrennt aufgewachsenen Zwillingen ergaben, dass 60-80% der BMI-Varianz genetisch bedingt ist. Jedoch nicht nur Körpergewicht und Fettmasse, sondern auch die individuelle Gewichtszunahme bei Überernährung bzw. die Gewichtsabnahme unter Reduktionsdiät werden durch genetische Faktoren wesentlich beeinflusst. Fast immer kann der adipöse Phänotyp als das Resultat einer Interaktion prädisponierender Erbanlagen mit Umweltfaktoren wie hyperkalorischer, fettreicher Ernährung und Bewegungsmangel interpretiert werden. Solche Erbanlagen können beispielsweise mit einer vermehrten Nahrungsaufnahme, einem verminderten Energieumsatz oder einer bevorzugten Energiespeicherung in Form von Fett assoziiert sein. Diese Eigenschaften stellten in Zeiten limitierter Nahrungsressourcen und somit während des größten Teiles der menschlichen Evolution einen Selektionsvorteil dar und konnten so genetisch fixiert werden. Erst in der heutigen Zeit mit einer fast unlimitierten Nahrungsversorgung in einigen Regionen der Erde erweisen sich die gleichen Erbanlagen als ungünstig für Gesundheit und Überleben. Die Tatsache, dass zahlreiche verschiedene Gene das Körpergewicht und die Pathogenese von Adipositas beeinflussen, macht ihre Identifizierung sehr schwierig. Dieser polygene Vererbungsmodus ähnelt der genetischen Konstellation bei anderen Komponenten des metabolischen Syndroms, wie Diabetes mellitus Typ 2, Dyslipoproteinämie und arterieller Hypertonie. Statt einem einfachen Mendelschen Erbgang zu folgen, scheint die genetische Prädisposition für diese Zivilisationserkrankungen aus der Addition verschiedener sogenannter Suszeptibilitätsallele zu resultieren. Keine dieser genetischen Varianten ist alleine für die Ausprägung des jeweiligen Phänotyps ausreichend oder notwendig, sondern erhöht lediglich das Risiko der Erkrankung. Seltene Ausnahmen hiervon stellen einige Formen syndromaler Adipositas dar, die auf der Mutation eines einzelnen Gens oder einer Chromosomenaberration beruhen. Häufigstes Beispiel ist mit einer Prävalenz von zirka 1:25.000 das Prader-Willi-Syndrom, welches eine schwere, stammbetonte Adipositas bei massiver Hyperphagie sowie Kleinwuchs, Intelligenzminderung und einen hypogonadotropen Hypogonadismus umfaßt. Keines der an den verschiedenen syndromalen Formen beteiligten Gene scheint jedoch für die hohe Prävalenz von Adipositas in unserer Bevölkerung relevant zu sein. Das Studium adipöser Tiermodelle, insbesondere die Identifizierung einer Mutation im Leptingen als eine Ursache von massiver Adipositas bei Mäusen, hat einem ganzen Forschungsgebiet großen Auftrieb verliehen. So konnten alle fünf weiteren Mutationen identifiziert werden, die für die monogenen Formen der Adipositas bei Nagetieren verantwortlich sind. Auch beim Menschen wurden vier seltene autosomal rezessive Formen von extremer Adipositas identifiziert, denen Mutationen in den Genen für Leptin, Leptinrezeptor, Prohormon-Con-vertase-1 (PC-1) bzw. Proopiomelanocortin (POMC) zugrunde liegen. Darüber hinaus wurden zahlreiche neue Proteine entdeckt, die an der Regulation von Nahrungsaufnahme, Energieverbrauch und den molekularen Mechanismen der Fettgewebedifferenzierung entscheidend beteiligt sind. Das daraus resultierende Screening der kodierenden Gene nach Mutationen und ihrer möglichen Assoziation mit Adipositas hat allerdings bisher zu keinem entscheidenden Durchbruch geführt. Die Untersuchung solcher Kandidatengene, wie dem b3-adrenergen Rezeptor oder den „Uncoupling Proteinen“ (UCP-1, UCP-2, UCP-3), ergab in keinem Fall eine eindeutige Relevanz von Polymorphismen für den adipösen Phänotyp. Das systematische Screening des gesamten menschlichen Genoms bei betroffenen Geschwisterpaaren könnte eine viel versprechende Möglichkeit sein, wichtige chromosomale Regionen mit den an der Entstehung von Adipositas beteiligten Genen zu identifizieren. Dieses könnte in der Zukunft die Diagnostik verschiedener Subtypen von Adipositas ermöglichen – mit entsprechenden Konsequenzen für Prävention sowie pharmakologische und verhaltenstherapeutische Behandlung (Bouchard et al., 1998).
3.2 Biochemie und Pathobiochemie des Fettgewebes
Die primäre Funktion des Fettgewebes beruht auf der spezifischen Fähigkeit von Fettzellen, Triglyzeride bei einer den Verbrauch übersteigenden Kalorienzufuhr zu speichern und andererseits aus diesen Fettsäuren und Glyzerin freizusetzen, wenn weniger Kalorien mit der Nahrung zugeführt werden als zur Deckung des Energiebedarfes notwendig sind. Substrate für die Triglyzerid-Biosynthese im Fettgewebe sind Kohlenhydrate und Lipide der Nahrung. Für eine vollständige Synthese aus Kohlenhydraten müssen neben dem Glyzeridanteil auch Fettsäuren vollständig aus Glukose synthetisiert werden. Glukose muss auf die Stufe von Acetyl-CoA abgebaut werden, das dann als Substrat der Fettsäuresynthese dient. Dieser Weg ist allerdings im menschlichen Fettgewebe von untergeordneter Bedeutung. Wichtiger ist hier die Fettsynthese aus triglyzeridreichen Lipoproteinen wie Chylomikronen oder VLDL. Die darin enthaltenen Triglyzeride werden im Kapillarbett des Fettgewebes durch Lipoproteinlipase zu Fettsäuren und Glyzerin gespalten, die Fettsäuren von Fettzellen aufgenommen, zu Acyl-CoA aktiviert und anschließend mit aus der Glykolyse stammendem a-Glycerophosphat verestert. Die Freisetzung der in der Fettzelle gespeicherten Triglyzeride erfolgt nach deren Abbau zu Fettsäuren und Glyzerin. Von regulatorischer Bedeutung ist, dass ein Teil der durch Lipolyse freigesetzten Fettsäuren in der Fettzelle wieder zu Acyl-CoA aktiviert und für einen Veresterungszyklus verwendet wird. Die Stoffwechselleistungen der Fettzelle hinsichtlich Lipogenese und Lipolyse unterliegen einer genauen hormonellen Regulation. Das wichtigste die Lipogenese stimulierende Hormon ist Insulin. Seine Wirkung beruht auf einer Steigerung der Glukoseaufnahme in die Fettzelle, die eine gesteigerte Glykolyse, eine Aktivierung der Pyruvatdehydrogenase mit gesteigerter Azetyl-CoA-Bildung und eine gesteigerte Fettsäurebiosynthese zur Folge hat. Darüber hinaus ist Insulin ein Induktor der für die Hydrolyse triglyzeridreicher Lipoproteine benötigten Lipoproteinlipase. Die wichtigsten Stimulatoren der Lipolyse sind Katecholamine, die das Adenylatzyklasesystem der Fettzelle über die b2- und in geringem Umfang über b3-Rezeptoren aktivieren. Darüber hinaus ist eine Stimulierung der Lipolyse auch mit Glukagon beschrieben worden. Glukokortikoide haben einen permissiven Einfluss auf die Lipolyse. Von Bedeutung ist ebenfalls, dass Fettgewebe nicht nur im Rahmen seiner metabolischen Aktivität in den Energiestoffwechsel eingreift, sondern eine Reihe biologisch aktiver Verbindungen sezerniert. Von besonderem Interesse ist in diesem Rahmen das Hormon Leptin, welches vom Fettgewebe in Abhängigkeit von der Fettmasse sezerniert wird. Außer dem Leptin werden im Fettgewebe Östrogen, der insulinähnliche Wachstumsfaktor IGF-I, die Zytokine TNFa und TGFb sowie eine Reihe von Komponenten des Komplementsystems sezerniert. Möglicherweise haben die genannten Faktoren eine Bedeutung beim Zustandekommen der mit Adipositas einhergehenden Insulinresistenz (Löffler, 1998; Ailhaud und Hauner, 1998).
3.3 Regulation der Nahrungsaufnahme
Die Nahrungsaufnahme ist von entscheidender Bedeutung für die Deckung des Energiebedarfes sowie für die funktionelle und anatomische Integrität des Organismus. Dies sichert das Überleben des Individuums und die Aufrechterhaltung der Spezies. Unter natürlichen Lebensbedingungen gibt es kein zu allen Zeiten im Übermaß vorhandenes Nahrungsangebot. Bevor Nahrungsaufnahme und damit Energiezufuhr erfolgen können, muss in der Regel zunächst Energie verbraucht werden. Im Falle einer erfolglosen Nahrungssuche entsteht zwangsläufig ein mehr oder weniger großes Energiedefizit, das zunächst aus den im Körper vorhandenen Energiedepots gedeckt werden muss. Dies bedingt, dass im Falle eines ausreichenden Nahrungsangebotes die Möglichkeit bestehen muss, entsprechende Energiereserven in Form von Fettgewebe anzulegen. Die Entstehung von Fettdepots ist deshalb etwas Physiologisches und ein Überlebensvorteil, solange es sich um ein temporäres Geschehen handelt. Die Drosselung der Nahrungsaufnahme durch das Regulationsprinzip der Sättigung dient nicht dazu, die Energieaufnahme zu blockieren, sondern zu optimieren. Eine temporäre Begrenzung der Nahrungsaufnahme ist erforderlich, um den Verdauungs- und Resorptionsvorgängen den notwendigen Zeitraum für eine Aufschlüsselung der Substrate im Darm und den anschließenden Transport in die Blutbahn zu verschaffen. Sättigung entsteht durch ein komplexes Zusammenspiel zwischen Magen-Darm-Trakt und Zentralnervensystem. Dehnungsreize innerhalb des Magens bewirken eine Aktivierung afferenter Bahnen des Nervus vagus, die wiederum in den übergeordneten Regulationszentren des Hypothalamus die Nahrungsaufnahme herunterregulieren. Innerhalb des Hypothalamus sind zahlreiche klassische und peptiderge Neurotransmitter – Noradrenalin, Serotonin, Cholezystokinin, Glucagon-like Peptid I, Neuropeptid Y, Galanin etc. – synergistisch an der Regulation beteiligt. Die Energieaufnahme bei sehr energiedichten, fettreichen Nahrungssubstanzen ist in vergleichbaren Zeiträumen höher als bei voluminösen aber insgesamt energieärmeren Nahrungssubstraten (Kohlenhydrate, Eiweiße, insbesondere Ballaststoffe). Diese grundlegenden Regulationsmechanismen werden sehr stark durch kognitive und sensorische Einflüsse über das Großhirn verändert. Die hedonistischen Qualitäten der Nahrung überspielen sehr schnell die Sättigungsregulation und begünstigen eine übermäßige Energieaufnahme (Blundell et al., 1993; Schick und Schusdziarra, 1994).
4. Risiken der Adipositas
Die klinische Relevanz von Übergewicht und Adipositas wurde in der Vergangenheit häufig unterschätzt. Wichtigstes Ziel der Adipositasbehandlung muss die Senkung von Inzidenz und Prävalenz der adipositasbedingten Folgeerkrankungen sein, um Morbidität und Mortalität der Bevölkerung in Deutschland entscheidend zu reduzieren. Wichtige Schrittmacher in diesem Zusammenhang sind Hypertonie, Diabetes und Hyperlipidämie, die auch unter dem Begriff des metabolischen Syndroms zusammengefasst werden.
4.1 Hypertonie
Eine arterielle Hypertonie ist die häufigste Begleiterkrankung der Adipositas. Die mit einer Million Teilnehmern bislang größte Prävalenzstudie fand bei noch nicht quantifiziertem Übergewicht eine Zunahme der Hypertoniewahrscheinlichkeit von 50% (Stamler et al., 1978). In der NHANES-II-Studie konnte in der gesamten Population (20 bis 75 Jahre) bei einem BMI > 27 eine dreimal höhere und bei jüngeren Adipösen (20 bis 45 Jahre) eine sechsmal höhere Hypertonieprävalenz festgestellt werden (Kuczmarski et al., 1994). Die PROCAM-Studie beschreibt ebenfalls eine kontinuierliche Beziehung zwischen BMI und Hypertonieprävalenz. 23,4% der Personen mit BMI 25,1-27,5 sowie 47,8% mit BMI > 30 kg/m2 wiesen einen arteriellen Hypertonus auf (Assmann und Schulte, 1992). Die Relevanz stammbetonter Adipositas drückt sich in der Verdoppelung der Prävalenz einer arteriellen Hypertonie bei Frauen (20 – 59 Jahre) mit einem Taillenumfang von > 88 cm gegenüber 80-87,9 cm, bei Männern mit einem Taillenumfang von > 102 cm im Vergleich zu 94-101,9 cm aus (Lean et al., 1995). Ein Schlüsselmechanismus für die Hypertonie bei stammbetonter Adipositas wird in der Insulinresistenz mit einer Aktivierung des Renin-Angiotensin- und des sympathischen Nervensystems gesehen (Tuck et al., 1981; Landsberg und Krieger, 1989). Gewichtsabnahme führt regelhaft zu einer Senkung systolischer und diastolischer Blutdruckwerte. Das Ausmaß der Blutdrucksenkung ist – einer Dosis-Wirkung-Beziehung entsprechend – der Gewichtsreduktion proportional (Reisin et al., 1983). Ein in 21 Wochen bei jungen übergewichtigen Patienten erreichter Gewichtsverlust um 7,1 kg übertraf den blutdrucksenkenden Effekt, der in der Kontrollgruppe mit einer medikamentösen Monotherapie (200 mg Metoprolol) erzielbar war (MacMahon et al., 1985). Eine prognoserelevante Blutdrucksenkung (> 5 mmHg diastol.) ist allein durch Gewichtsabnahme zu erzielen (Goldstein, 1992).
Weitere Berichte rund um das Thema Gesundheit unter
http://www.apimanu.com/apimanu-MedJournal.html