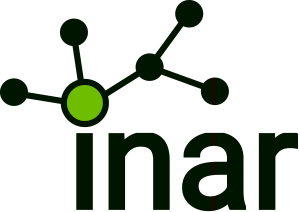Gesundheitsrelevante Themen polarisieren. Wie wichtige Entscheidungen politisch gefällt werden, zeigt ein aktuelles Forschungsprojekt des Wissenschaftsfonds FWF am Beispiel der HPV-Impfung auf.
Wie reifen politische Maßnahmen? Wer sind ihre Akteurinnen und Akteure? Wann kommt es zur Einführung von Strategien, wann nicht, und wie werden politische Entscheidungen in die Praxis umgesetzt? Am Beispiel gesundheitspolitischer Maßnahmen liefert die Politikwissenschafterin Katharina T. Paul Aufschluss über gesellschaftspolitische Prozesse, indem sie ihren Fokus auf diese und ähnliche Fragestellungen richtet. Durch ein Lise-Meitner-Stipendium des Wissenschaftsfonds FWF von Rotterdam nach Wien zurückgekehrt, hat Paul die Einführung der HPV-Impfung zur Krebsvorsorge untersucht. Die Ergebnisse werden im Fachjournal „Social Science & Medicine“ veröffentlicht.
Umstrittenes Thema
In den Jahren 2006 und 2007 wurden erstmals weltweit Impfstoffe zugelassen, die vor allem Mädchen und Frauen gegen mehrere Stämme des sexuell übertragenen humanen Papilloma-Virus (HPV) immunisieren sollten, auch solche, die Gebärmutterhalskrebs verursachen. „Diese medizinische Innovation wurde nicht überall mit Begeisterung aufgenommen“, erklärt Projektleiterin Paul von der Universität Wien. Im Gegenteil, das von Expertinnen und Experten vorgeschlagene Impfkonzept, Kinder gegen sexuell übertragene und krebserregende Viren zu schützen, wurde zu einem höchst umstrittenen politischen Thema mit Auswirkungen auf die Impfpolitik und auf bestehende Präventionsprogramme gegen Gebärmutterhalskrebs.
Von der Gefahr zur Innovation
Wie die kontrovers geführten Diskussionen in Österreich verliefen, und wer ihre Akteurinnen und Akteure waren, hat Paul in Gesprächen mit Verantwortlichen aus Medizin, Politik, Industrie, der Zivilgesellschaft und Behörden rekonstruiert und der Einführung der HPV-Impfung in den Niederlanden gegenübergestellt. Dort wurde nach anfänglichen Bedenken die Impfung bereits 2008 national implementiert. Auch in anderen europäischen Ländern erfolgte die Umsetzung zügig. In Österreich dauerte der Prozess mehrere Jahre. Mit dem Ergebnis, dass die HPV-Impfung 2013 als „europäischer Vorreiter“ in das Kinderimpfkonzept aufgenommen wurde. Im Vergleich zu den Niederlanden, wo nur Mädchen (ab 13 Jahren) eine kostenfreie Impfung erhalten, werden in Österreich aktuell sowohl Mädchen als auch Buben ab 9 Jahren immunisiert.
Erfolgsentscheidend
Die Einführung einer medizinischen Technologie sei nie einfach, konstatiert Katharina Paul, die sich vor allem für präventive Praktiken interessiert, und für die Tatsache, dass diese länderübergreifend sehr verschieden sind. Im konkreten Fall hat die Wissenschafterin aufgezeigt, wie die österreichischen Entscheidungsträger des föderalistisch organisierten Gesundheitssystems an Konzepten, ökonomischen Argumenten und der Impf-Infrastruktur selber feilten, so dass schließlich eine Akzeptanz seitens der Öffentlichkeit erwartet werden konnte. „Dazu waren drei Punkte wichtig“, erklärt Paul: Erstens sei es gelungen, das Thema zu de-sexualisieren, indem sowohl Mädchen als auch Buben bereits vor der Adoleszenz geimpft werden sollten und die Impfung damit vom gynäkologischen Produkt zur Kinderimpfung wurde. Zweitens konnte man durch die Aufnahme in das Kinderimpfprogramm Diskussionen mit den Eltern leichter umgehen. Und drittens wurde die Impfung von drei auf zwei Dosen reduziert, so dass die Umsetzung innerhalb eines Schuljahres möglich war.
Kultur und Evidenz
Die Entscheidung, ob etwa ein nationales Impfprogramm umgesetzt wird oder nicht, ist das Ergebnis von vielen, auch informellen und zum Teil intransparenten Diskussionen, wie die Untersuchungen Pauls zeigen. Dabei kommen viele Faktoren zum Tragen, ob ein medizinischer Fortschritt wie die HPV-Impfung zur vielversprechenden Innovation oder zur sozial unerwünschten Technologie wird. „Medizinische Versorgungspraktiken und Selbstverständlichkeiten sind stark von gesellschaftlichen Diskursen geprägt, nicht nur von Evidenz“, sagt Paul und nennt das Beispiel Niederlande: Dort werden PAP-Tests ab 30 Jahren im Abstand von fünf Jahren empfohlen.
Mehr Forschung
Dass die Papilloma-Viren auch andere Krebsarten, wie den Analkrebs auslösen können, das sei in Österreich allerdings gar kein Thema gewesen, so Paul. Auch die bis heute standardmäßigen, aber teils kritisch beurteilten Gebärmutterhalskrebs-Screenings durch den PAP-Test, wurden zwar anlässlich der neuen Präventionsmaßnahme neu diskutiert, allerdings ohne Ergebnis. „Ursprünglich sollte es Verbesserungen geben, aber es ist nicht viel passiert.“ Insgesamt würde sich Paul mehr Datenerhebung zum Impfverhalten allgemein wünschen, ebenso wie Überlegungen zu einem zentralen Impfregister. „Es gibt rund um das Thema Impfen nicht nur Für und Wider, sondern viele Unsicherheiten“, so die Forscherin. Die Sozialwissenschaften könnten hier einen wichtigen Beitrag leisten, ist Katharina Paul überzeugt.
Wissenschaftlicher Kontakt:
Dr. Katharina T. Paul
Institut für Politikwissenschaften
Universität Wien
Universitätsstraße 7
1010 Wien
T +43 /1 /4277-47738
E katharina.t.paul@univie.ac.at
W www.univie.ac.at
Der Wissenschaftsfonds FWF:
Marc Seumenicht
Haus der Forschung
Sensengasse 1
1090 Wien
T +43 / 1 / 505 67 40 – 8111
E marc.seumenicht@fwf.ac.at
W http://www.fwf.ac.at
Aussendung:
PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung
Mariannengasse 8
1090 Wien
T +43 / 1 / 505 70 44
E contact@prd.at
W http://www.prd.at