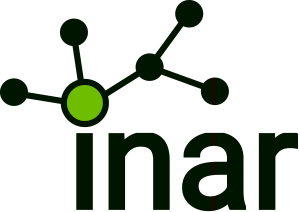Die EU soll dafür bezahlen, wenn in Italien, Frankreich oder anderen Ländern Autowerke geschlossen werden. Ein entsprechender Plan, den der Fiat-Chef und Präsident des europäischen Verbandes der Automobilhersteller Acea, Sergio Marchionne, seit Monaten verfolgt, wird nach Informationen der „Welt am Sonntag“ (20. Mai 2012) von der EU-Kommission wohlwollend geprüft. Marchionne hatte in seiner Funktion als Acea-Präsident vorgeschlagen, dass die Hersteller beim Abbau von Produktionskapazitäten Zugriff auf verschiedene EU-Töpfe haben sollten, um die Folgen für betroffene Mitarbeiter und Regionen zu lindern.
„Wir werden auf die Wünsche der Industrie hören“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission der Zeitung. Marchionne und die französischen Automobilhersteller hatten im Gegenzug für die EU-Hilfe angeboten, die Ziele der Kommission zur Reduzierung des Treibhausgases CO2 akzeptieren zu wollen – Vorgaben, die eigentlich für alle Hersteller in der EU nach Inkrafttreten automatisch verbindlich sind. Das wird in Brüssel als Entgegenkommen in der Diskussion um die Begrenzung des Schadstoffausstoßes gesehen und fördert ganz offensichtlich die Zahlungsbereitschaft der Kommissare. Das Auto werde einen wichtigen Beitrag leisten, Europas Industrielandschaft neu zu formen, sagt der Sprecher der EU-Kommission: „Wenn wir einen Umbau hin zu energieeffizienteren Produkten wollen, braucht es dafür in allen Sektoren ein Minimum öffentlicher Anreize.“ Fiskalpakt hin, Schuldenbremse her: „Es lohnt sich für Europa, die Industrie auf einen Weg zu drängen, den sie allein nur langsam beschreiten würde.“ Doch das Problem ist: Auf die Lage der Autoindustrie passen die Förderschemata der EU nicht – bislang. Ist aber eine neue Strategie fürs Auto der Zukunft, die der Kommissar vorbereitet, erst Programm, könnten die Hersteller beginnen zu träumen. Von Fördermitteln und günstigen Krediten der Europäischen Investitionsbank EIB oder gar der Europäischen Zentralbank. „Warum sollen allein die Banken billiges Geld bekommen, nicht aber die Industrie?“, fragt ein zuständiger EU-Beamter. Bei den Autobauern Italiens und Frankreichs waren die Absatzzahlen in Süd- und Westeuropa nicht zuletzt wegen der Euro- und Schuldenkrise dramatisch eingebrochen. Fiat-Chef Marchionne hatte schon im März ein Positionspapier in Umlauf gebracht, in dem er politische Unterstützung verlangt. „Die europäische Autoindustrie befindet sich in einer kritischen Situation“, heißt es in dem Papier, das dem Blatt vorliegt. Nötig sei eine EU-weite Industriepolitik, die die „langfristige Wettbewerbsfähigkeit und die Unterstützung der Restrukturierung der Branche“ sichere. Zielführender als Alleingänge der Hersteller bei der Bewältigung dieser Aufgaben sei eine „gemeinsame Anstrengung der Politik auf europäischer Ebene“. Von einem „schrumpfenden Markt, signifikanten Überkapazitäten, hohen Kosten, wachsendem Wettbewerb durch Importe und geringer Profitabilität“ berichtet auch eine überarbeitete, aber unveröffentlichte Version des Papiers. Sie listet Versäumnisse der Industrie auf – und stellt sie als Folge „struktureller“ Probleme dar, die einzelne Hersteller nicht lösen können. Die Verfasser fordern daher Zugriff auf EU-Mittel zur Abfederung der Globalisierungsfolgen, auf Geld aus einem Sozialfonds und dem Budget zur regionalen Entwicklung, „um vom Abbau betroffene Mitarbeiter umzuschulen und die Folgen in betroffenen Regionen zu mildern“. Die deutschen Automobilhersteller indessen mauern, sie sehen sich massiv benachteiligt – außerdem wollen sie Werke eröffnen, nicht schließen. Lässt man die US-Töchter Ford Deutschland und Opel außen vor, sind die Autokonzerne in Deutschland seit zwei Jahren erfolgreich wie nie. „Uns geht es blendend. Und nun sollen die in der Branche, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, mit dem Geld der Steuerzahler aufgepäppelt werden“, meint ein deutscher Automanager. Ein anderer sagt es ähnlich: „Hier geht es darum, einem Teil der europäischen Hersteller unter die Arme zu greifen – jenen, die sich nicht aus eigener Kraft saniert haben. Dafür fehlt uns das Verständnis.“