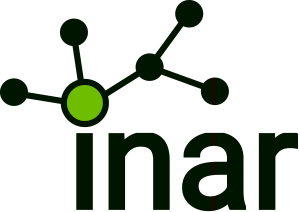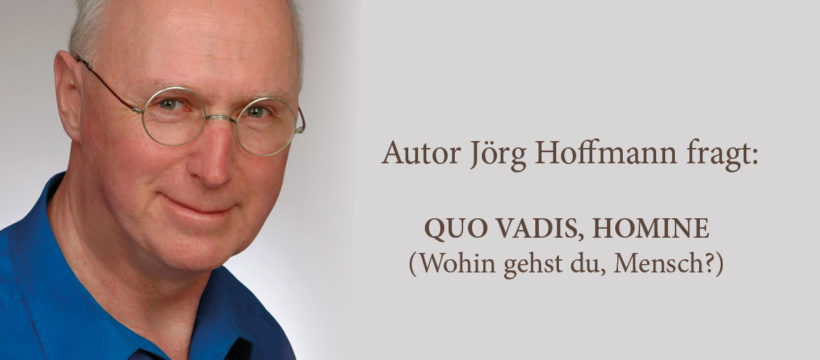Jörg Hoffmann über sein kürzlich erschienenes Buch »QUO VADIS, HOMINE«:
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Das hat damit zu tun, dass ich meine Pubertät nie ganz hinter mir gelassen habe. Pubertierende sind im Denken und ihrer Meinung oft gleichermaßen instinktgetrieben wie scharfsinnig. Die nicht Traumatisierten und Brutalisierten unter ihnen sind zumeist recht lebenslustig, aber auch leicht wütend, und klagen offensichtliche Ungerechtigkeiten noch direkt und oft mit sehr klugen und trefflichen Gedanken an, ohne sich aus Furcht um die Konsequenzen für die eigene Biografie zu verbiegen, siehe fridays for future. Bei Erwachsenen herrscht dagegen im Zuge der üblichen Korruption durch Konsum, Karriere sowie bleierner Normalität und Saturiertheit vornehmlich die sogenannte „Vernunft“ vor – oder eben, je nach Neigung und Betroffenheit, die Gewaltfantasie dumpfen Wutbürgertums. Aber die gute, alte konservative „Vernunft“ des kapitalistischen Systems (Uns-geht’s-doch-so-gut!) ist in die Krise gekommen. Spätestens seit 2008 wird sie allenthalben in vielerlei Gestalt sichtbar: Bankenkrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, Gesellschaftskrise, soziale Krise, Umweltkrise, Demokratiekrise, Gesundheitskrise, Rentenkrise, Klimakrise, Globalisierungskrise, Corona-Krise usw. usw. Die Krise ist zum Dauerzustand geworden – und sie nimmt noch weiter Fahrt auf. Und im ruhigen Zentrum des tosenden Krisen-Zyklons wirkt, wie die Spinne im Netz, das Geldsystem.
Mich hat es im gutpubertären Sinne einfach wütend gemacht, dass die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft – wie übrigens vorauszusehen war – immer wieder nur oberflächliche Reförmchen an Marktwirtschaft und Geldsystem propagieren, statt ernsthaft und konsequent über Alternativen nachzudenken. Aus diesem Grunde sah ich mich genötigt, grundlegende Gedanken in die Debatte zu werfen, die aber im großen Meer des allgemeinen Mainstream-Diskurses in Politik und Medien unterzugehen drohen. Daher entschied ich mich, sie in Buchform zu veröffentlichen. Sicherlich hätte ich per Youtube ein breiteres Publikum erreichen können, aber ich gehöre nun mal zur altvorderen Analog-Generation. Und außerdem: Was nicht ist, kann ja noch werden.
Wie lange haben Sie an dem Buch geschrieben?
Sehr lange, aber nicht zu lange. Denn die fünf Jahre seit Sommer 2015 hat es für Quo vadis, homine gebraucht. Zum einen sind es ja quasi zwei Bücher, die aber wie Yin und Yang zusammengehören: der Midas-Effekt und das Auenland-Projekt. Neben diesem quantitativen Grund ist die lange Dauer jedoch auch der Eigenart des philosophischen Denkens geschuldet. Denn das Denken nimmt, anders als eine Zugverbindung, keinen geschienten Verlauf. Allenfalls ist dabei ungefähr abzusehen, in welche Richtung der Zug zieht, aber nicht, wie weit er fährt, wo er ankommt, ja noch nicht einmal, wo er entlangfährt. Oft stellen sich Nebenwege als Königswege heraus. Das macht die Sache interessant, denn es zwingt dazu, sich zu konzentrieren. Das bedeutet, dass man die Fülle der einschlägigen Literatur durchstöbern und sie mit dem eigenen Thema in Verbindung setzen muss. Dieser Dialog braucht vor allem Zeit, da man vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Oder anders gesagt: Alles hängt tatsächlich mit allem zusammen. Während des Denkweges ändern sich dann immer wieder die eigenen Denk-Gleise.
Zwischenzeitlich befürchtete ich ja insgeheim, dass mein Buch überflüssig sein würde. Es hätte ja sein können, dass die Gedanken vielleicht schon längst von anderer Seite veröffentlicht worden wären oder dass sie sich als Sackgasse erweisen würden, also als haltlos, als inkonsequent, als zu naiv oder zu kurz gedacht. Aber dem war ganz und gar nicht so. Ich war wirklich überrascht, dass meine Gedanken zum Werdegang unseres way of life, jedenfalls in dieser Gesamtkonzeption, bisher anscheinend noch nicht gedacht worden sind. Und sie erweisen sich zunehmend als äußerst treffend und haltbar.
Was ist Ihnen besonders wichtig beim Inhalt dieses Buches?
Meine Absicht in Quo vadis, homine ist es eigentlich nicht, in die „letzte große Schlacht“ gegen den Kapitalismus zu ziehen oder die Machenschaften herrschender Kreise zu entlarven. Jedenfalls nicht nur. Denn das haben vor mir schon viele andere getan. Insbesondere Männer haben für solche Kreuzzugsmentalität eine große Vorliebe. Die Literatur ist voll davon, und einige sind ausgezeichnete, treffsichere und großartige Analysen. Aber sie stellen nur die Negation dar. Sie zeigen – fast ausnahmslos – keine Alternativen und bieten auch keinen Ausblick, wie man es besser machen könnte. Denn nach dem militärischen Sieg ist der große Krieg ja zu Ende. Und dann? Diesbezüglich bleiben die „Feldherren“ meist ungenau. Die Empfehlungen reichen von immer aufmüpfig bleiben und weiterhin Sand ins Getriebe streuen bis zu systeminternen Reformen des Geldsystems, wodurch bestimmte Schwarze Peter des Kapitalismus angeprangert und aussortiert werden sollen, wie zum Beispiel der Wachstumsfetisch, die Zinsen, die Investmentbanken oder gar die gierigen Bänker. Das alles ist meines Erachtens jedoch nur ein Kampf gegen Windmühlen.
Mir geht es in meinem Buch darum, eine positive und lebensbejahende Utopie eines umfassenden Kulturwandels vorzustellen, mit dem wieder das Wohlergehen von Menschen und andere Lebewesen ins Zentrum allen Trachtens gestellt wird und nicht ein abstraktes, zerstörerisches, lebensverneinendes System, dem wir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Und das geht nur, indem wir eine andere Beziehung zur Natur als unserer einzigen Lebensgrundlage einnehmen. Arbeit darf für uns nicht mehr vorrangig Produzieren sein, sondern sollte eher im Hüten unserer natürlichen Lebensgrundlage bestehen. Damit würden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Einerseits würden unsere eigentlichen Bedürfnisse und nicht mehr unsere Konsumsucht befriedigt und andererseits würde sowohl unsere soziale als auch unsere natürliche Umwelt nachhaltig geschont.
Lange Rede, kurzer Sinn: Während der Midas-Effekt zeigt, dass nicht nur die Überwindung des Kapitalismus, sondern vielmehr des Geldsystems an sich alternativlos ist, stellt mein Auenland-Projekt einen Weg für den längst überfälligen, grundlegenden Kulturwandel vom zunehmend automatisierten Produzieren zum technikgestützten, gelassenen Hüten vor. Meines Erachtens ist das der einzig gangbaren Ausweg hinein in eine menschenwürdige Zukunft.
Haben Sie schon andere Bücher geschrieben?
Jein! Mein Buch Entscheidung in Delphi. Die Kunst, philosophierend die Welt zu retten habe ich vor 15 Jahren fertiggestellt, aber keiner der renommierten Verlage hat sich dafür interessiert. Und so wanderte das Manuskript in die Mottenkiste. Wenn Quo vadis, homine erst mal veröffentlicht ist, werde ich vielleicht doch wieder mal einen Blick darauf werfen.
Schreiben Sie weitere Bücher?
Mit Sicherheit! Es für mich die einzige Möglichkeit, nicht vollends dem Zynismus anheim zu fallen. Denn schließlich sind wir alle vereinzelte und vereinsamte Konkurrenten und Konsumenten auf winzigen Single- und Kleinfamilieninseln im großen Meer des Spätkapitalismus. Um das deutlich zu machen, brauchte es nicht erst Covid-19.
Was findet man, wenn man Sie googelt?
Außer meiner Website www.denkwuerdig.info findet man nichts von Bedeutung. Aber das kann sich ja täglich ändern; die Schnelllebigkeit des Internets macht´s möglich.
 978-3-03830-580-4, Quo vadis, homine
978-3-03830-580-4, Quo vadis, homine
Jörg Hoffmann, Taschenbuch, 492 Seiten 14,00€/18,20CHF
Paramon-Verlag