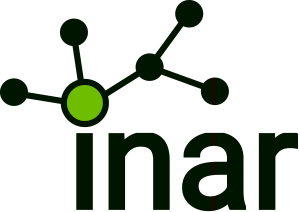Innerhalb der Euro-Zone gibt es nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwochausgabe) erneut Streit über die Vergabe von Hilfsgeldern aus dem Schutzschirm EFSF. Eine Reihe von Regierungen sowie namhafte Vertreter aus der Spitze der Europäischen Zentralbank plädieren nach Angaben aus Verhandlungskreisen dafür, die Kriterien für die Vergabe von EFSF-Krediten für Fälle zu lockern, in denen das Hauptproblem nicht im Staatshaushalt, sondern in einem maroden Bankensektor liegt. In diesen Fällen, so das Ansinnen, soll der EFSF direkt und ohne den bisher üblichen Umweg über die betroffene nationale Regierung Geld an die kränkelnden Institute überweisen können. Zu den Befürwortern einer lockereren Kreditvergabe zählt dem Vernehmen nach die spanische Regierung, für die die Haushaltsfinanzierung über die Finanzmärkte zuletzt immer teurer geworden ist.
Für den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy hätte das diskutierte Modell gleich drei handfeste Vorteile: Er wäre sein Bankenproblem los, seine Regierung müsste – anders als bei bisherigen Hilfspaketen – keine strengen Spar- und Reformauflagen erfüllen und die Staatsschuldenquote bliebe konstant. Auch Spitzenvertreter der Europäischen Zentralbank befürworten den Vorschlag, weil die EZB im Bemühen um eine Stabilisierung des Bankensektors nicht länger auf sich allein gestellt wäre. Verlierer wären hingegen die wichtigsten EFSF-Geberländer, allen voran Deutschland: Sie könnten die Empfängerländer nicht länger zu Reformen zwingen und wären im Falle einer Bankenpleite überdies ihr Geld los. In Berlin stößt die Idee deshalb auf harsche Ablehnung: „Spanien braucht kein Hilfsprogramm – und wenn es eins bräuchte, dann nur zu den bekannten Konditionen“, hieß es in Regierungskreisen. Eine direkte Auszahlung von EFSF-Mitteln an private Banken sei im übrigen rechtlich gar nicht zulässig.