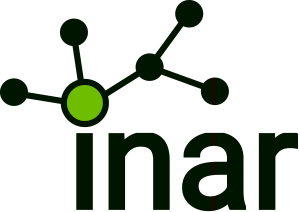Deutschland ist auf einen Atomunfall wie in Fukushima nicht ausreichend vorbereitet. Dies berichtet das Nachrichten-Magazin „Der Spiegel“ in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Radioaktive Stoffe würden demnach weit größere Räume verseuchen als bislang angenommen, ganze Städte müssten evakuiert werden – dies sei „nicht in der Notfallplanung vorgesehen“, heißt es in einer bislang unveröffentlichten Studie des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS).
Die Fachleute des Bundesamts hatten verschiedene Atomunfälle simuliert. Sie kombinierten Wetterdaten aus dem Jahr 2010 für die Kernkraftwerke Philippsburg 2 und das mittlerweile stillgelegte AKW Unterweser mit Unfallverläufen, die denen in Japan vor einem Jahr ähneln. In Deutschland gingen Experten bislang davon aus, dass nur „über mehrere Stunden oder Tage“ radioaktive Stoffe freigesetzt würden. Das Kraftwerk Fukushima Daiichi blies dagegen mehrere Wochen lang Strahlenstoffe in die Umwelt. „Es ist ein völlig neues Szenario“, sagt Wolfgang Weiss, Vorsitzender des Uno-Strahlenkomitees UNSCEAR. Die BfS-Forscher spielten Szenarien über jeweils 15, 25 oder 30 Tage durch. Dabei wurden große Gebiete verstrahlt, für die keine Evakuierungspläne existieren. Menschen bis zu 100 Kilometer vom AKW Philippsburg entfernt dürften ihre Häuser nicht mehr verlassen. In dem Szenario wechselten die Windrichtungen häufig, die Notfallmaßnahmen kämen daher schnell an ihre Grenzen. Die Studie verdeutlicht auch ein grundsätzliches Problem: In deutschen Notfallplänen gelten sogenannte Eingreifrichtwerte – wenn sie überschritten werden, muss der Staat handeln. Diese Grenzwerte sind um ein Vielfaches höher als die Grenzwerte, welche die japanischen Behörden anwandten. Kritiker monieren, das Bundesumweltministerium habe die Ergebnisse seit vergangenem Jahr unter Verschluss gehalten. Das Ministerium bestreitet dies; die „Annahmen, die der Studie zugrunde liegen“, würden nun geprüft, die Studie selbst werde später veröffentlicht, heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums.